Foto oben: das vor 6.900 Jahren errichtete Sonnenobservatorium von Goseck zur Winter-Sonnen-Wende 2016
Ein einzener Mensch vermag beim Singen sehr viel mehr mit seinem Stimmapparat anzufangen, als lediglich auf einer von der Gesellschaft aufgestellen Ton-Leiter in vereinbartem Rhythmus auf- und abwärts zu tanzen, um damit exakt das ertönen zu lassen, was gemeinhin als Melodie erkannt wird. Nichts spricht gegen die Annahme, dass vor Zeiten mit der menschlichen Stimme auch in völlig anderer Weise als heute musiziert wurde. Auf allen vom Homo Sapiens bewohnten Kontinenten lassen sich Spuren einer ganz anderen Vokal-Musik nachweisen: bei den Innuit im Norden Amerikas, den Xoosa-Frauen von Südafrika, auf den Philippinen, in der Mongolei und auch in Europa – vom Joiken der Saamen bis zu den sardischen Tenores. Selbst für Australien könnte dies gelten, wenn man bereit wäre, das Didgereedoo-Spiel als eine mit Eukalyptusholz ausgebaute Überhol-Spur solcher Gesänge zu verstehen: nicht der einzelne, isolierte und von allen Nebenklängen („akustischer Gangart“) befreite, der raffinierte Ton, die pure Sinus-Schwingung einer bestimmten Frequenz also wird gewürdigt und gepflegt, sondern Klang, der sich über ein breites Spektrum von hörbaren Frequenzen erstreckt.
Dass solch hörbares Werkeln den Anspruch erheben kann, als Musik verstanden zu werden, hat spätestens der französische Komponist Gérard Grisey (1946-1998) mit seiner musique spectrale gezeigt – von daher die sprachliche Anleihe: Spektralgesänge.
So weit voneinander geografisch entfernt die Fundorte dieser Kulturspuren, so weit untereinander entfernt erscheinen sie auch klanglich. Lediglich in Südsibirien und in der angrenzenden nordwestlichen Mongolei (bei den Tuvinern) hat sich eine sehr breite Palette sogenannter Stile nebeneinander erhalten, in der sich die Mehrzahl der weltweit praktizierten Spektralgesangs-Stile spiegelt: dies ist wohl auch eine regionale Besonderheit. Dort gibt es noch einige Sänger, die zwei oder mehr dieser Stile beherrschen und einsetzen, im allgemeinen zeitlich nacheinander, auch wenn vom selben Sänger verschiedene Stile im gleichen Lied verwendet werden.
Die Gemeinsamkeit der Spektralgesänge liegt darin, dass beim Singen der primäre, an den Stimmlippen erzeugte Stimmklang (der sog. Grundton) musikalisch, gestalterisch und bei der Wahrnehmung in den Hintergrund gedrängt wird, während die von der ausströmenden Atemluft erzeugten Geräusche, Ober- und Untertöne zu prägenden und wesentlichen Gestaltungselementen des Gesangsvortrages werden.
Es hat zunächst einzig physiologische Gründe, weshalb beim Spektralgesang die Liedtexte und die Sprache akustisch zugunsten einer virtuosen Klangformung zurück treten (müssen). Vermutlich waren es diese objektiven Umstände, welche dazu führten, dass die katholische Kirche bei der Christianisierung germanischer Stämme die einheimischen Sänger als völlig unbrauchbar für die Liturgie einstufte – entsprechende Expertisen aus dem 9. bzw. 10. Jahrhundert deuten darauf hin.
Ein vom Papst ausgeschickter Scout hieß Adamarus (der sog. Mönch von Angoulême), und der berichtete seinerzeit nach Rom: richtige Gesänge „… konnten sie (die Franken) mit ihren barbarischen Stimmen nicht herausbringen, sie vermochten die Töne weder ordentlich zu binden, noch zu trennen und es trat selbst Stimmbruch ein, d.h. die Stimme schlug ihnen über…“ Wie auch andere Kritiker verglich er das Gebrüll dieser „ewig durstigen“ Kehlen mit dem Gepolter eines abwärts rollenden Lastwagens und mit dem Geheul der Wölfe.
vgl.: Adolf Beyschlag: Die Ornamentik der Musik; 2. Auflage 1953 (Erstausg. Sept 1908); VEB Breitkopf & Härtel Leipzig; S. 3f
Die älteste bislang bekannte wissenschaftliche Beschreibung solcher Gesänge stammt von Georg Wilhelm Steller (1709-1746), der an der „Großen Nordischen Expedition“ (1733–1743) von Vitus Bering teilnahm und der von den auf Kamtschatka lebenden Itelmenen und ihrer Kultur berichtete. In einer Textpassage stellt er das Stimmphänomen sachlich und mit wenigen Worten sehr genau dar, eingebettet in eine Beschreibung itelmenischer Tänze:
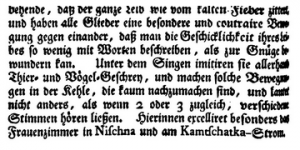
„…und haben alle Glieder eine besondere und contraire Bewegung gegen einander, daß man die Geschicklichkeit ihres Leibes so wenig mit Worten beschreiben, als zur Gnüge bewundern kan. Unter dem Singen imitiren sie allerhand Thier- und Vögel-Geschrey, und machen solche Bewegungen in der Kehle, die kaum nachzumachen sind, und lautet nicht anders, als wenn 2 oder 3 zugleich, verschiedene Stimmen hören ließen. Hierinnen excelliret besonders das Frauenzimmer in Nischna und am Kamtschatka-Strom.“
(1741/42 Reisetagebuch, gedruckt 1774 Frankfurt/Leipzig, Seite 340)